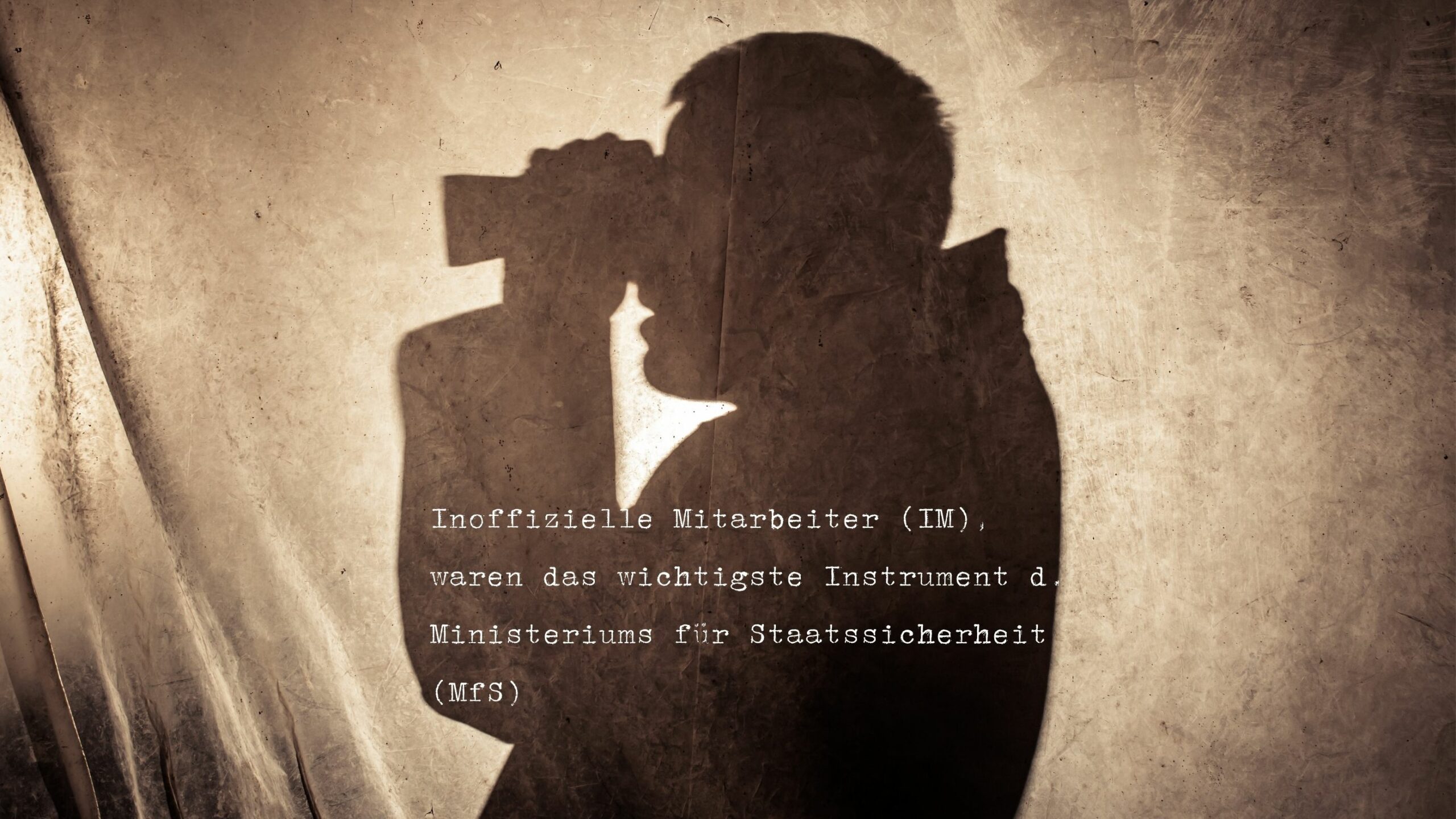Eine fruchtbare Diskussion
und eine Antwort auf eine sehr persönliche Frage
Kürzlich ist auf meiner Facebookseite rund um den Film „Nahschuss“ (Regie: Franziska Stünkel) eine rege und feine Diskussion entstanden, an der der sich zu meiner großen Freude viele Menschen beteiligt haben, die aus der DDR stammen, und aus eigenem Erfahren und Erleben berichten, worüber wir anderen ja mehr oder weniger nur spekulieren können.
Diesen wichtigen und sehr nahegehenden Film möchte ich allen empfehlen, die noch immer und immer wieder dieses durch und durch verkommene, perfide und verbrecherische Regime schönreden, verklären und Sätze sagen, wie „Es war nicht alles schlecht in der DDR“.
Denn richtig müsste es heißen: Es war nicht für alle schlecht!
Sich immer wieder vor Augen zu führen, auf welchem menschenverachtenden Fundament dieses System bis zu seinem Niedergang überdauern konnte, erklärt vieles, was eigentlich unerklärbar ist. Das durchlebt bzw. überlebt zu haben und heute in unserem wiedervereinigten Deutschland von eingeschränkter Meinungsfreiheit oder gar Diktatur zu plärren, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Auch wenn es erschütternd ist.
An einer Stelle in der Diskussion habe ich konkret nachgefragt, wie die betreffende Person es empfunden haben mag, ihr eigenes Leben auf hunderten Seiten in Akten und aus der Sicht der vom Staat instruierten BeobachterInnen zu lesen.
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Vertrauen dieses Mannes, um den es im nachfolgenden Text geht, und möchte die Antwort auf meine Frage hier mit Ihnen bzw. euch teilen:
____________________________________________________________
Wie fühlte es sich an,
das eigene Leben auf hunderten Seiten STASI-Akten nachzulesen?
U. hat mich gebeten, seine Zeilen zu anonymisieren.
Er schreibt:
Es war vor allem überraschend. Danach kam Bestürzung. Eine bis heute anhaltende.
Als ich Einsicht in meine Akten nehmen konnte, war vieles noch in baulichen Provisorien untergebracht. Ich musste eine Weile in einem kleinen Warteraum warten, bis ich aufgerufen wurde.
DDR-Plattenbau, das Ambiente passte zum Anlass. Ein Mitarbeiter rief mich in einen Korridor. Er schob einen Aktenwagen voller Ordner. Ich realisierte erst, als er mich im Leseraum mit dem Wagen alleine ließ, dass es alles meine Akten waren. Etliche Ordner waren leer, aber auf dem Rücken beschriftet. Der Inhalt war schon vernichtet oder zumindest geschreddert und in Säcken verpackt. Sie sollten später restauriert werden.
Ich habe lange erst geblättert, um eine Übersicht zu erhalten. Einige Vorgänge habe ich durch die Zeitgeschichte verfolgt, besonders die „Operativen Vorgänge“. In zweien war ich Hauptfigur.
Damals schrieb ich die Texte zu den Liedern eines Freundes. Ziel von „Operativen Vorgängen“ war immer die Zersetzung der Persönlichkeiten der Opfer, um sie damit unschädlich für die „Diktatur der Arbeiterklasse“ zu machen.
In meinem OV war das Ziel an die „Informellen Mitarbeiter“ schriftlich fixiert. Sie sollten mich in Situationen bringen, in denen ich mich rechtswidrig verhalten muss, mit dem Ziel der nachfolgenden Inhaftierung. (Es kam jedoch nie dazu.)
Voller Verwunderung entfaltete sich aus den Spitzelberichten, den Observationen, den Maßnahmenplänen, ein Leben, welches ich in meiner eigenen Erinnerung überhaupt nicht geführt hatte. Ein Groteske sondergleichen ergab sich aus den Berichten aus und über mein Alltagsleben im Abgleich mit meiner eigenen Erinnerung. Fast alles, was Spitzel für berichtenswert hielten, hatte ich vollständig vergessen.
An manche Dinge konnte ich mich selbst nach dem Aktenstudium nicht erinnern. Skurrile Nebensächlichkeiten (der U.K. fuhr mitten in der Arbeitszeit zur technischen Kontrolle mit seinem PKW) und freiphantasierte Interpretationen (der U.K. schob den Kinderwagen J., es ist davon auszugehen, dass er mit dieser eine sexuelle Beziehung unterhält), bildeten ein Sammelsurium aus Episoden in meinem Leben, von der sich Spitzel wie Führungsoffiziere versprachen, sie eigneten sich für Erpressungen und Verwendbarkeit in Strafprozessen.
Die erste tiefgreifende Bestürzung stellte sich ein, nachdem mir der Mitarbeiter die Bedeutung einer DIN-A6-Karteikarte erklärt hatte, die sich in der Akte befand, deren Bedeutung aber nicht ersichtlich war. Jedenfalls handelte es sich um die Kategorisierung für die im „Krisenfall“ zu internierenden Personen.
Mein Internierungslager wäre das Zentralstadion in Erfurt geworden.
Vielleicht klingt es sehr pathetisch, Aber mir wurde dort schlagartig klar, wie nah man der vollständigen Katastrophe sein kann, ohne einen Hauch von Ahnung dieser Nähe. Ich kannte die Bilder der Stadien in Chile, im Jahr 1973. Natürlich war mir völlig klar, dass sich die Staatssicherheit für mich interessierte. Ich lebte seit Jahren in einer oppositionellen Community und war Mitglied des höchsten evangelischen Kirchenparlaments, der Synode des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR. Dass aber gleich 12 Personen beauftragt wurden mich zu überwachen, damit hätte ich nie und nimmer gerechnet.
Mit der Hälfte dieser Leute war ich zu diesem Zeitpunkt seit Jahren eng befreundet. Es gab dabei Berichte von solch engagierter Niedertracht, dass mir buchstäblich der Atem stockte ob der Sicht auf mich, die mich zu einer Karikatur meiner selbst machte.
Keiner, nicht einer, hat sich entschuldigt, bis heute nicht.
Es gab aber auch Berichte, aus denen ablesbar war, dass der Schreiber wortreich nichts mitteilen wollte.
Nach ein paar Lesestunden fasste ich den Entschluss, alle Spitzelberichte, die von persönlichen Freunden verfasst waren, in Kopie mitzunehmen und sie ihnen auszuhändigen als Basis für eine gemeinsame Aufarbeitung dieses Teils der gemeinsamen Geschichte.
Das habe ich bald darauf gemacht.
Einer hat mit mir tatsächlich zwei Mal intensiv geredet.
Das fühlt sich nicht nur nicht gut an, sondern absurder Weise hat die Stasi damit postum eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht: Die Zersetzung von Beziehungen unter den Menschen, die die Opposition einer sächsischen Kleinstadt bildeten.
(Titelbild: CanvaPro)
Link zur Diskussion auf Facebook:
https://www.facebook.com/HiernichtSenden/posts/pfbid0NdccVERLGfrPS78w5xeeesrn9SPkSvtwaMqrifzMfQvBY8ZG8fWLCwVLDFQnJo6Kl
1989 waren mindestens 3.000 Bundesbürger inoffiziell im Dienste des MfS, zusätzlich mehrere Hundert Ausländer. In der Zeit von 1949 bis 1989 waren insgesamt mindestens 12.000 Bundesbürger und Westberliner IM.
Der Anteil von weiblichen IM lag in der DDR bei 17 Prozent, in der Bundesrepublik bei 28 Prozent. Über die Hälfte der IM war Mitglied der SED. Von den 2,3 Mio. Mitgliedern der Partei ausgehend, waren 4 bis 5 Prozent zuletzt inoffiziell aktiv, d. h. jedes 20. SED-Mitglied. (Quelle: Literatur: Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit)